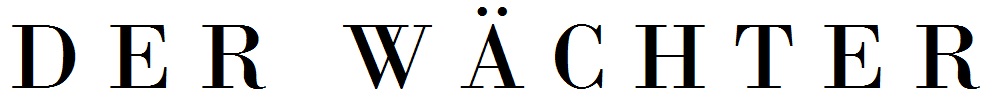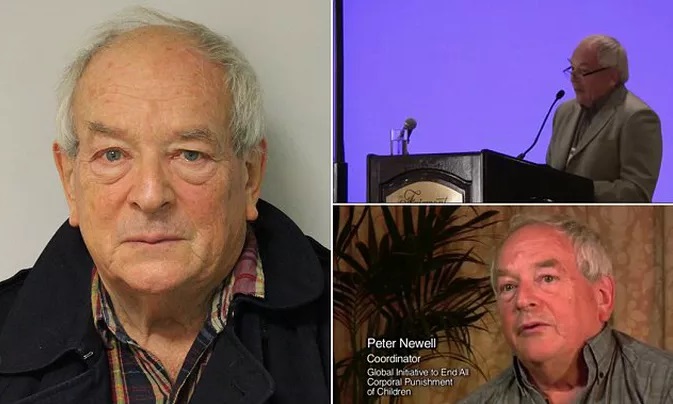Der Milliarden-Überschuss ist kein Erfolg, sondern ein Armutszeugnis
Deutschland hat 2017 einen Überschuss von 36,6 Milliarden Euro erzielt. Das klingt gut, zeugt aber nur von schlechter Politik.
BerlinDie schwäbische Hausfrau ist das Leitbild der deutschen Finanzpolitik – mit ihrer schwarzen Null als unbestrittenem Ziel. Im letzten Jahr war die Null so tiefschwarz, dass man eigentlich nicht mehr umhin kann, sie einen Überschuss zu nennen. Der Staat, einschließlich Sozialversicherungen, hat 1,1 Prozent der Wirtschaftsleistung weniger ausgegeben als eingenommen.
Was wie ein Erfolg daherkommt und weithin auch so kommentiert wird, ist schlechte Politik. Ja, es stimmt schon, dass die Staatsverschuldung geringer wird, und dass das für sich genommen eine gute Sache ist. Aber es wiegt bei Weitem nicht die Nachteile und vergebenen Chancen auf.
Die sparsame schwäbische Hausfrau ist ein Segen, solange sie das macht, was sie gut kann: mit einem gegebenen Budget so haushalten, dass es reicht und für unvorhergesehene Ausgaben oder schlechte Zeiten eine gewisse Reserve da ist. Aber wenn sie nach diesem Prinzip auch das Regiment über den Familienbetrieb übernimmt, dann wird es kritisch. Dann gibt es kein vorgegebenes Budget, sondern es muss investiert werden, damit später die Einnahmen stärker fließen.
Lässt die wildgewordene schwäbische Hausfrau nur aus den laufenden Einnahmen finanzierte Investitionen zu, und besteht sie zusätzlich noch darauf, zu sparen, um die ererbten Schulden zu begleichen, dann sieht es schlecht aus für den Betrieb. In schlechten Zeiten wird gespart und nicht investiert. In guten Zeiten wird nur das Nötigste investiert und der Überschuss für Schuldentilgung verwendet. So kann sich die Hausfrau jedes Jahr für ihre schwarze Null feiern, bis der Betrieb irgendwann wegen technischer Veraltung und Rückständigkeit zumachen muss.
Weiterlesen auf handelsblatt.com